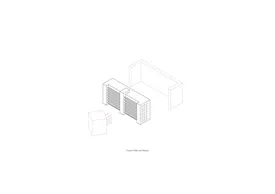Informationen zur Master Thesis an unserem Lehrstuhl sind hier zu finden:
DAS UMGEBAUTE HAUS
Umbau von Einfamilienhäusern seit 1977
Sommer 2025_Annalisa Müller
Der Einfamilienhausbestand in Deutschland steht vor großen Herausforderungen. Viele Gebäude sind energetisch sanierungsbedürftig und aufgrund der sinkenden Belegung räumlich überdimensioniert. Gleichzeitig verfügen sie über wertvolle Substanz, gewachsene Strukturen und große Grundstücke – Potenziale, die durch gezielte Umbauten aktiviert und weiterentwickelt werden können.
Vor diesem Hintergrund beschäftigt sich die Arbeit mit bereits realisierten Umbauprojekten im Einfamilienhaussektor, die seit 1977 in der Zeitschrift Das Haus veröffentlicht wurden, um daraus fundierte Erkenntnisse für den zukünftigen Umgang mit dem Bestand zu gewinnen. Ausgangspunkt ist das Erstellen einer strukturierten Datensammlung der 281 erhobenen Umbauprojekten, die eine Grundlage für Forschung und Praxis bildet. Die anschließende Analyse ermöglicht es, räumliche, funktionale und typologische Strategien im Umbau von Einfamilienhäusern zu identifizieren. Die Untersuchungen und Erkenntnisse werden visuell ansprechend aufbereitet, sodass komplexe zahlenbasierte Fakten verständlich werden und ein Beitrag zur baukulturellen Bildung geleistet wird. Zusätzlich dokumentiert ein Projektbeispielkatalog gebaute Lösungen aus der Praxis und sensibilisiert für die Möglichkeiten des Weiterbauens. Ergänzt wird die Arbeit mit der Zeitschrift Das umgebaute Haus, welche die zentralen Ergebnisse in einem populärwissenschaftlichen Medium zusammenführt und an das Ausgangsprodukt, die Zeitschrift Das Haus, anknüpft.
Betreuung_Prof. Andreas Hild, Wiss. Mit. Valerie Kronauer M.A., Wiss. Mit. Mascha Zach M.Sc.
VON STOCKHOLM NACH MÜNCHEN
Referenzen aus Dänemark und Schweden in der Münchner Nachkriegsarchitektur
Sommer 2024_Florian Bramann
Im Jahr 1955 reiste Josef Wiedemann zum ersten Mal nach Schweden, um Gebäude, die er zuvor nur von Abbildungen kannte, mit eigenen Augen zu sehen. Zu diesem Zeitpunkt war der wohl bekannteste schwedische Architekt, Erik Gunnar Asplund, bereits seit 15 Jahren verstorben und hatte Bauten aus verschiedenen Architekturstilen hinterlassen.
In der Literatur zur Münchner Nachkriegsarchitektur ist der skandinavische Einfluss auf Münchner Architekten keine neue These. Diese Arbeit stellt erstmals acht Münchner Gebäude den dänischen und schwedischen Vorbildern gegenüber. Dabei zeigt sich eine gemeinsame Architektursprache, insbesondere bei drei Paaren: das Stockholmer Stadthaus und die Allianz Generaldirektion, das Göteborger Rathaus und die Erweiterung der Dresdner Bank sowie das Krematorium und die Aussegnungshalle auf den Waldfriedhöfen in Stockholm und München. Die beschriebenen Vergleiche machen jedoch auch deutlich, dass sich Architekten wie Erik Gunnar Asplund oder Ragnar Östberg in eine Reihe eingliedern und klare Referenzen auf vorherige Werke erkennbar sind. Es wird außerdem deutlich, dass der Ursprung der Referenzen bei den Münchner Bauten nicht immer in Schweden oder Dänemark liegt, sondern dass gemeinsame Vorbilder bestehen, an denen sich orientiert wird. So zeigt die Allianz Generaldirektion nicht nur direkte Bezüge zum Stockholmer Stadthaus, sondern lässt auch einen gemeinsamen Vergleich mit dem Dogenpalast in Venedig erkennen.
Betreuung_Prof. Andreas Hild, Wiss. Mit. Valerie Kronauer M.A.
MEFALA +
Umbaustrategien für Laubenganghäuser der Nachkriegsmoderne
Sommer 2024_Lennart Reidelbach
Mit Blick auf die Zukunft stehen die Gebäudebestande der 1960er- und 1970er-Jahre vor komplexen Herausforderungen. Der demographische Wandel, der Klimaschutz und eine sich fortschreitend verändernde Gesellschaft, verlangen nach einer umfassenden Qualifizierung und Anpassung der Wohnungsbestände. Wie wir diese Transformation gestalten und nicht bloß bewältigen, ist von entscheidender Bedeutung, besonders wenn sich notwendige Umwandlungen flächendeckender Baubestände krisenbedingt beschleunigen. Die NEBourhoods Aktion „Wohnen Weiterbauen“ untersucht als Forschungsprojekt, wie die baulichen Defizite bestehender Wohngebäude verbessert werden können. Ziel ist es, durch Fassadensanierung und Erweiterung bestehender Wohnflächen eine energetische Aufwertung und gleichzeitig einen sozialen Nutzen zu schaffen. Im Rahmen dieser Arbeit wird dieses Ziel weiterverfolgt und die vom NEBourhoods-Projekt skizzierten Umbaustrategien aus Anbau und Raumschicht werden auf den Bautypus Laubenganghaus übertragen. Die historische Herkunft und Entwicklung sowie die bestehende Grundrissstruktur dieses Bautypus wird zuerst untersucht. Letztendlich wird der Fokus auf die Großwohnsiedlung Nordweststadt in Frankfurt gelegt. Anschließend daran werden unterschiedliche Umbauszenarien entworfen und miteinander verglichen, um die geeignetsten Umbaumöglichkeiten für Laubenganghäuser vorzuschlagen.
Betreuung_Prof. Andreas Hild, Wiss. Mit. Stefan Gruhne M.A.
ENERGIEBONUS SÜDTIROL. ERFOLGSMODELL UND CHANCE
Analyse der lokalen Auswirkungen und Evaluierung der Übertragbarkeit der Strategie auf Bayerns Ein- und Zweifamilienhäuser
Sommer 2024_Raphael Großmann
Der deutsche Immobilienmarkt ist gegenwärtig von einer hohen Nachfrage nach Wohnraum geprägt. Die Anzahl jährlich neu entstehender Wohnungen ist nicht ausreichend, um die Situation angemessen zu entspannen. Nicht zuletzt aufgrund des Anteils von Einfamilienhäusern am Wohngebäudebestand der Bundesrepublik Deutschland muss das Einfamilienhaus aus statistischer Sicht in die Debatte des Wohnraummangels eingeführt werden. Es stellt sich die Frage nach geeigneten Fördermechanismen, um einen Anreiz bei Eigentümern zu schaffen, ihre Immobilien entsprechend zu transformieren. Der Blick nach Südtirol zeigt hierfür ein starkes Konzept. Mit der Förderstrategie Energiebonus können bestehende Wohngebäude im Zuge einer energetischen Sanierung erweitert werden. Diese Strategie wird in Südtirol seit 2009 erfolgreich angewendet. Das Ziel der Masterthesis besteht darin, die Auswirkungen der Förderstrategie Energiebonus aus Südtirol auf den lokalen Einfamilienhausbestand zu untersuchen. Im Rahmen dessen wird ebenso einbezogen, inwieweit hierdurch die energetischen Zustände der Gebäude beeinflusst werden. Basierend auf den gewonnenen Forschungserkenntnissen der Arbeit wird abschließend evaluiert, wie diese Strategie auf bayerische Einfamilienhausquartiere übertragen werden kann.
Betreuung_Prof. Andreas Hild, Wiss. Mit. Valerie Kronauer M.A., Wiss. Mit. Stefan Gruhne M.A.
EINFAMILIENHÄUSER
Nachverdichtung durch Umbau bestehender Ein- und Zweifamilienhäuser
Sommer 2024_Magdalena Schadhauser_Leonard Khanmoradi
In Zeiten steigender Wohnraumnachfrage und begrenzt verfügbarer, bezahlbarer Wohnfläche könnte die Nachverdichtung bestehender Ein- und Zweifamilienhäuser eine effektive Strategie darstellen, um dem zukünftigen Bedarf an Wohnraum besser gerecht zu werden. Das Ziel dieser Arbeit ist, anhand der bestehenden Bebauung eines beispielhaften Straßenzugs im Stadtgebiet München, insbesondere von Ein- und Zweifamilienhäusern, eine Typologie der Gebäude zu erstellen und daran exemplarisch mögliche Umbaumaßnahmen zur Nachverdichtung zu untersuchen. Die Typologisierung erfolgt anhand von Merkmalen der Gebäude, welche bezüglich der darauf anwendbaren Maßnahmen relevant sind. Somit soll einerseits herausgefunden werden, inwieweit die Einteilung nach Typen auf eine größere Datenmenge anwendbar ist, und andererseits, ob diese Umbaumaßnahmen in großem Umfang sinnvoll umsetzbar sind. Anhand der Typologisierung werden pro Umbaumaßnahme zwei Gebäude herangezogen und die jeweilige Umbaumaßnahme genauer behandelt. Die Umbaumaßnahmen werden zusätzlich auf ihre aktuelle Machbarkeit hinsichtlich baurechtlicher Vorgaben beurteilt. Abschließend werden die Ergebnisse kritisch reflektiert und ein Ausblick in die Zukunft der Stadtentwicklung vorgenommen.
Betreuung_Prof. Andreas Hild, Wiss. Mit. Valerie Kronauer M.A., Wiss. Mit. Stefan Gruhne M.A.
EINFAMILIENHÄUSER
Analyse von Vorstadtgebieten
Sommer 2023_Fabian Schneider
Die momentane Lage auf dem deutschen Immobilienmarkt ist durch eine hohe Nachfrage nach Wohnraum und gleichzeitig rückläufigen Entstehungszahlen für neue Wohnungen geprägt. Diese Entwicklung führt auf Dauer zu einem großen Defizit an Wohnraum. Deshalb wird nach Wegen gesucht, schnell und effizient neuen Wohnraum zu schaffen. Bei Einfamilienhäusern wurde dafür bisher kein Potential gesehen. Im Rahmen dieser Arbeit soll überprüft werden, in wieweit Einfamilienhaussiedlungen nachverdichtet werden können und welche Kriterien maßgeblich sind für eine Abschätzung des in Vorstadtgebieten vorhandenen Potenzials. Der Fokus lag dabei auf dem Stadtgebiet Münchens, das als Gebiet mit angespannter Wohnlage
gilt. Es wurde eine Methodik entwickelt, die eine bessere Analyse und Kategorisierung der vorhandenen Bebauung in Vorstadtgebieten ermögicht. Zusätzlich beinhaltet die Arbeit Methoden zur Bewertung und Durchsetzung von Erweiterungs– und Umbaumaßnahmen in bestehenden Siedlungsstrukturen.
Daraus soll ein nachhaltiger und effektiver Lösungsansatz für das Wohnraumproblem in München entstehen. Durch die Anwendung dieser Systematik auf verschiedene Siedlungen in München soll eine Einschätzung des Nachverdichtungspotenzials ermöglicht werden.
Betreuung_Prof. Andreas Hild, Prof. Faraneh Farnoudi