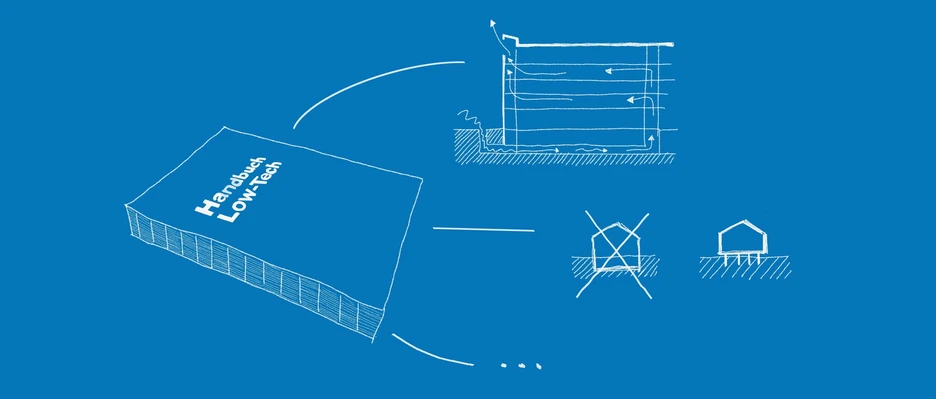
Handbuch Low-Tech – Low-Tech als Strategie einer nachhaltigen Architektur
Buchpublikation „Low-Tech-Handbuch“: Low-Tech als Strategie einer nachhaltigen Architektur
„Low-Tech“ ist dabei, sich als Begriff im Gebäudebereich zu etablieren. Darauf weisen die zahlreichen Grundlagenarbeiten sowie die vermehrten Verlagspublikationen in diesem Feld hin (Detail, Birkhäuser). Für den wissenschaftlichen Bereich weist das Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften für den Begriff „Low-Tech“ in den Fächern Bautechnik und Architektur ab ca. 2009 einen signifikanten Anstieg aus, der sich bis 2012 mehr als verzehnfacht hat. Seit 2020 rangiert der Begriff bei ca. 2.000 Nennungen pro Jahr. Dennoch: Bücher in diesem Bereich fokussieren sich auf ausgewählte Typologien (bspw. wie im Büro- oder Pavillonbau), auf einzelne Baustoffe (vor allem Ziegel- und Lehmbauweise) oder auf ausgewählte Aspekte wie die Gebäudekühlung. Hier wird zumeist auf Best-Practice-Vorhaben und die Beschreibung erfolgreicher Leuchtturmprojekte gesetzt. Über die Herausforderungen und die zu ihrer Bewältigung geeigneten Instrumente gibt es kaum Grundlagen, zudem fehlt ein stringent strukturiertes und niederschwellig aufbereitetes Kompendium, als Handreichung für all jene, die an der weiteren Verbreiterung maßgeblichen Anteil haben werden: die Bauverwaltung, Bauträger und Planende. Dazu braucht es auch eine Unterstützung in der Kommunikation mit Nutzern, Betrieb- oder Personalräten. Das umfasst auch den Aspekt der Nutzung und der Nutzereinbindung, der im Verhältnis zu bautechnischen Fragen im Kontext von Low-Tech zu wenig beachtet wird. Das „Handbuch Low-Tech“ soll diese vorhandenen Lücke schließen und eine umfassende und vor allem anwendungsorientierte Orientierungshilfe anbieten.
Nach dem Stand der Forschung ist „Low-Tech“ die Suche nach einer menschzentrierten, ressourcen- und energiesparenden Designstrategie. Das „Handbuch Low-Tech“ bildet dazu eine anwendungsorientierte Handreichung. Es bezieht sich auf grundlegende Design-Prinzipien des einfachen und robusten Bauens und eignet sich daher sowohl für den Anwendungsfall Neubau als auch die Sanierung, für Büro- über Verwaltungs- bis hin zu Wohnbauten. Aufbauend auf dem derzeitigen Stand des Wissens über Anforderungen, Wirkungsweisen und Zusammenhänge unterstützt es die Beteiligten in einer immer komplexer werdenden Baupraxis.
Anhand von „Mustern“ werden die Prinzipien des einfachen und robusten Bauens strukturiert, kontextualisiert und in ihrer Anwendbarkeit und Wirkungsweise veranschaulicht. Das Handbuch knüpft dabei an die Herangehensweise von Christopher Alexander und seiner „Mustersprache“ an.
Die Muster sind systematisch aufgebaut und grafisch als auch textlich einheitlich aufbereitet. Die Muster folgen Prinzipien, sind zu Kapiteln und übergeordneten Themen zusammengefasst und gliedern den Inhalt des Handbuchs.
Um den Einstieg zu erleichtern zeigen Beispiele oder Statements aus Diskussionen und Interviews besondere Merkmale oder spezifische Herausforderungen. Dadurch soll der Begriff Low-Tech seiner noch starken Wissenschaftlichkeit ein zugänglicher Praxisbezug zur Seite gestellt werden. Dazu wird Low-Tech als Aushandlungsprozess und als Teil einer laufenden und lange zurückreichenden Entwicklung kontextualisiert. Ziel ist, dass die Muster auf wiederkehrende Anwendungsfälle übertragen werden können, die das gesamte Spektrum von der Bedarfsplanung bis zur Nutzung abdecken, ohne sich zu eng am momentanen Stand der Technik zu orientieren. Dadurch soll das Handbuch selbst eine gewisse Robustheit und Langlebigkeit erhalten.